Monika Scheidler
Interkulturelles Lernen in der Gemeinde
Analysen und Orientierungen zur Katechese unter Bedingungen kultureller
Differenz
Reihe Zeitzeichen (Band 11)
Schwabenverlag Ostfildern 2002
Wie
können Lernprozesse in multikulturellen Gemeinden und wie können katechetische
Gruppen mit Menschen unterschiedlicher kultureller Prägung gelingen? Es
geht um Fragen der Sprache, um oft sehr unterschiedliche Erwartungen an
die Katechese, um kulturspezifische Verhaltensweisen, um unterschiedliche
Glaubensverständnisse. Die Autorin untersucht die Probleme und Chancen
der Interaktion zwischen Einheimischen und Zugewanderten aus humanwissenschaftlicher
Sicht und entwickelt vor diesem Hintergrund theologische sowie religionspädagogische
Orientierungen für interkulturelle Lernprozesse im Kontext christlicher
Gemeinden.
Format 16,5 x 24 cm Klappenbroschur 500 Seiten EUR 25,00 [D] / sfr 43,00 ISBN 3-7966-1084-6 (Verlagstext)
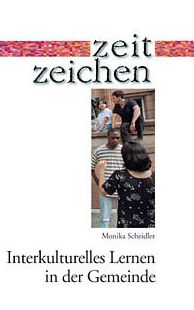
 |
Monika Scheidler, Dr. theol. habil., geboren 1962. Studium der Theologie, Anglistik und Erziehungswissenschaften in Münster. Seit 2002 Professorin für Religionspädagogik am Institut für Katholische Theologie der Technischen Universität Dresden, davor zwei Jahre Vertretung der Professur. (Verlagstext)
Prof. Dr.
Monika Scheidler bei der Tagung |
Besprechung
Immer mehr Kirchengemeinden nehmen verwundert zur Kenntnis, wie international sie zusammengesetzt sind. Wie aber wird eine traditionell deutsch geprägte Gemeinde zu einem Stück "Welt-Kirche"? Monika Scheidler zeigt in ihrer Habilitation "Interkulturelles Lernen in der Gemeinde" Wege auf, die vielerorts dringend gesucht werden. Mit ihrem Werk gibt es nun eine umfassende Grundlegung für pastorale Arbeit in Kirchengemeinden mit Minderheiten von Christen anderer kultureller Herkunft. Erfahrungshintergrund ist vor allem die Situation in der Diözese Rottenburg-Stuttgart mit ihren ca 94700 italienischen Katholiken sowie die Aussiedlerpastoral. Die meisten Ausführungen sind aber auch problemlos übertragbar auf andere Diözesen bzw. Gemeinden mit entsprechenden ausländischen oder Aussiedler-Minderheiten.
Monika Scheidler beschreibt sehr wirklichkeitsnah die faktische Situation deutscher und ausländischer Christen in ihren Gemeinden. Kritisch beleuchtet sie die bisherige kirchliche Praxis, für ausländische Katholiken sogenannte "Missionen" einzurichten und drängt darauf, diese Phase der Separation zu überwinden.
Gründlichst beschreibt sie nun die Prozesse des Miteinanders bzw. (noch) Nicht-Miteinanders von deutschen und ausländischen Katholiken in örtlichen Gemeinden. Zur Deutung dieser Vorgänge greift sie auf die ganze Breite der humanwissenschaftlichen Diskussion hinsichtlich Ausländerfeindlichkeit, Integration und interkulturellem Lernen zurück.
Im Detail erhebt sie die psycho-soziale und religiöse Situation von Einheimischen und Zugewanderten und findet damit wesentliche Ursachen für Hemmnisse im Verhältnis der verschieden-kulturellen Gruppen einer Kirchengemeinde. Dabei ist von Bedeutung, dass der größere Teil der in Deutschland lebenden Italiener auf die Phase der "Gastarbeiter" zurückgeht, daher hierzulande meist Arbeiterstatus besitzt, während sich die einheimischen Gemeindemitglieder überwiegend aus der Mittelschicht rekrutieren. Zusätzlich konstatiert sie ein "heimliches Programm" (S. 182) der (meist) unbewussten Abschottung einheimischer Gemeinden und Gruppen gegenüber ihren zugewanderten Mitchristen, das von der Angst der Einheimischen vor Veränderung her rührt.
Monika Scheidler ermuntert zu beharrlichen und zugleich behutsamen Lernprozessen bei Ausländern wie Einheimischen gleichermaßen. Für die einheimischen Gemeindemitglieder mahnt sie eindeutige Zeichen der Öffnung an und macht auch Vorschläge, wie eine solche Öffnung aussehen könnte (z.B. interkulturelle Trainings). Sie geht davon aus, dass sich auch die Einheimischen auf die Zugewanderten hin integrieren müssen, soll tatsächlich interkulturelles Lernen in Gang kommen, während die Zugewanderten ohnehin unter starkem Anpassungsdruck stehen.
Für die zugewanderten bzw. ausländischen Gemeindemitglieder empfiehlt sie eine Doppelstrategie (z.B. S. 187): Einerseits ist die Integration nachhaltig zu fördern, zugleich brauchen die Einheimischen wie die Zugewanderten Räume, in denen sie ihre eigene kulturelle Identität pflegen und entwickeln können. Es braucht also Gruppen und Treffen, in denen sich Einheimische und Zugewanderte kennenlernen und begegnen können. Es braucht aber auch Rückzugsräume (Gruppen, Vereine ...), in denen die Migranten ihre eigene kulturelle Identität pflegen können. Es geht darum, einen Raum zu schaffen , "in dem der andere sich verstanden, als Person ernst genommen und wertgeschätzt wird." (S. 189) Zusätzlich können die Gemeinden eine wertvolle Funktion übernehmen, indem sie "im Kontakt mit Migranten, Umsiedlern und Flüchtlingen wichtige Stützfunktionen zur Bewältigung der Akkulturationsanforderungen übernehmen." (S. 300)
Um bei der interkulturellen Zielsetzung der kirchlichen bzw. gemeindlichen Arbeit weiterzukommen, sind klare Schwerpunktsetzungen auch im strukturellen und personellen Bereich notwendig. (S.223/224) In den z.B. in der Diözese Rottenburg Stuttgart angestrebten "Gemeinden anderer Muttersprache", die jeweils in einer Seelsorgeeinheit als zusätzliche Personalpfarrei für eine bestimmte Nationalität eingerichtet wurden, sieht Monika Scheidler durchaus eine Möglichkeit, Integration und Bewahrung der kulturellen Identität miteinander zu vereinbaren (S. 288).
Bevor sie spezifisch auf die Katechese als Bereich interkulturellen Lernens eingeht, entwirft sie im Anschluss an James W. Fowler ein Modell abgestufter religiöser Identität (S. 314). In den Grundzügen stellt sie ein traditionelles, unreflektiertes (synthetisch-konventionelles) Glaubensverständnis einem sich-selbst-bewussten (individuierend-reflektierenden) Glaubensverständnis gegenüber. Dabei geht sie davon aus, dass die erstere Kategorie vor allem in gemeinschaftlich ausgerichteten kulturellen Milieus (wie z.B. in den Mittelmeerländern) existiert, während der reflektierte Glaube eher in individualistisch geprägten Kulturen (Deutschland, USA usw...) zu Hause ist.
Ihre Schlussfolgerung, die Mehrzahl der Migranten gehöre zur ersteren Kategorie und die Mehrzahl der Einheimischen zur letzteren, ist m.E. nicht ohne Brisanz. Obwohl in der Theorie einiges daran richtig sein mag und Monika Scheidler mehrmals betont, dass damit keine Wertung des Glaubens verbunden ist, scheint mir diese Aufteilung für die Praxis eher hinderlich, weil sie die Akzeptanz der fremden Glaubenskultur durch die einheimischen Christen behindern kann, denn indirekt heißt die Konsequenz dann: Die Glaubenskultur der zugewanderten Christen muss überwunden werden auf eine "höhere" Stufe hin.
Kirche ist aufgrund der kulturenübergreifenden religiösen Gemeinsamkeiten ein guter Ort für interkulturelles Lernen. Gerade der biblischen Verkündigung misst Monika Scheidler einen hohen integrativen Wert zu. Bestimmte biblische Bilder und Worte können Wirklichkeit aufbrechen auf gemeinsames Neues hin. (S. 232)
Als Konkretion ihrer Überlegungen entfaltet Monika Scheidler Grundlinien einer interkulturell orientierten Gemeindekatechese, welche die spezifischen kulturellen und sprachlichen Bedingungen auch der zugewanderten Gemeindemitglieder berücksichtigt. Sie wünscht, dass möglichst bald auch entsprechende Materialien für eine kulturverbindende Katechese verfasst und veröffentlicht werden.
Gerade der Bereich der Sakramentenkatechese mit seinem hohen Anteil an ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen könnte ein spannendes Experimentierfeld interkulturellen Lernens werden. Dass hier noch einiges zu tun ist, zeigt, dass eine in der Diözese Rottenburg Stuttgart im Oktober 2002 geplante Fortbildung über interkulturelle Erfahrungen in der Sakramentenkatechese mangels Teilnehmer nicht zustande kam.
Von Anfang bis Ende des Buchs bleibt Monika Scheidler realistisch und fordert zu behutsamem Vorgehen auf, weiß um die vielen Enttäuschungen, die mit interkultureller Arbeit verbunden sind, vertraut auf sensible, aber beharrliche und reflektierte Bemühungen, um miteinander "Volk Gottes auf dem Weg" zu sein.
Thomas Raiser
Stuttgarter Str. 10/1
70736 Fellbach
Tel. 0711 588110
0174 4514546
Mail th.raiser@web.de
Die italienische Übersetzung der Buchbesprechung wurde gefertigt durch Mariella Guidotti und ist erschienen in STUDI EMIGRAZIONE (Rivista trimestrale del Centro Studi Emigrazione Roma) Nr. 153, März 2004, S.218 - 220
Recensione
Monika
Scheidler
Interkulturelles Lernen in der Gemeinde
Analysen und Orientierungen zur Katechese unter Bedingungen kultureller
Differenz
Reihe Zeitzeichen (Band 11)
Schwabenverlag Ostfildern 2002
È
in aumento il numero delle parrocchie che, con sorpresa, predono atto
della loro composizione internazionale. ...
Monika Scheidler
descrive in modo realistico la situazione dei cristiani tedeschi e stranieri
nelle parrocchie. ... Descrive quindi in modo approfondito i processi
della convivenza o meglio della (ancora) non-convivenza di cattolici
tedeschi e stranieri nelle parrocchie territoriali. ... La Scheidler
ha modo di constatare inoltre un "programma secreto" (p. 182)
di chiusura (per lo più) inconsapevole delle parrocchie e dei
gruppi autoctoni nei confronti dei fedeli immigrati: chiusura che nasce
dalla paura di fronte al cambiamento. ... Dall'inizio fino alla fine
del libro, Monika Scheidler rimane realistica: invita ad un'azione cauta
e non nasconde le molte delusioni collegate con il lavoro interculturale.
Ma ha fiducia nell'apporto degli sforzi, sensibili, constanti e sorretti
da riflessione, per essere insieme "popolo di Dio in cammino".
____________________________________________________________________________________
Verborgene
Schätze:
Italienische Kirchenlieder für Kinder und Erwachsene
_________________________________________________________________